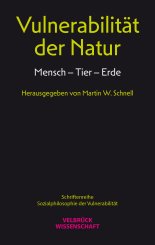Neuerscheinungen
Aktuelles
Neuigkeiten aus unserem Verlag
Verlagsprogramm 2. Halbjahr 2025
30.06.2025
Hier finden Sie unser Verlagsprogramm für das 2. Halbjahr 2025: Download Verlagsprogramm 2. Halbjahr 2025 (PDF)
Velbrück Wissenschaft auf dem ÖGS Kongress 2025
25.05.2025
Der 28. Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie findet unter dem Leitthema »Das Klima der Gesellschaft« vom 30. Juni bis 2. Juli an der Universität Graz statt. Wir sind für Sie vor Ort mit einem Stand auf der Verlagsausstellung und freuen uns, ...

Velbrück Verlage mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet
27.09.2024
Die Velbrück Verlage (Velbrück Wissenschaft, Dittrich, v. Hase & Koehler und Barton) werden mit dem Deutschen Verlagspreis 2024 in der dotierten Kategorie ausgezeichnet. Kulturstaatsministerin Claudia Roth betont die gesellschaftliche Relevanz unabhängiger Verlage: ...


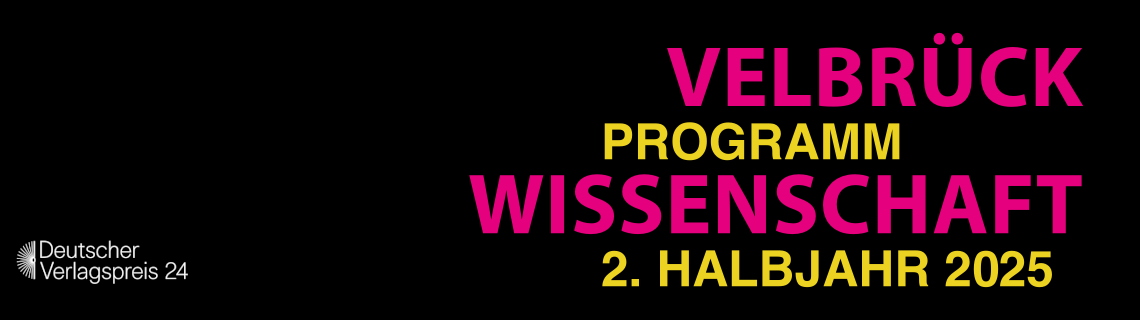

.png)